Oh, wie schön ist Panama – US-amerikanische Actionhelden in Lateinamerika (Teil 2)
Von Oliver Nöding // 9. Januar 2012 // Tagged: Action, Charles Bronson, Christopher Walken, Chuck Norris, featured, James Glickenhaus, Lateinamerika, Mengele, Pablo Escobar, Robert Ginty // 4 Kommentare

Im ersten Teil meines Essays zum Actionfilm mit Südamerika-Bezug hatte ich versucht, mit einem kleinen einführenden Exkurs über die politischen Beziehungen zwischen den USA und Südamerika das Fundament für die anschließende Beschäftigung mit den Filmen zu legen: Die innenpolitischen Probleme in den Ländern Südamerikas – Militärdiktatur, schmutzige Kriege, Rebellion und Putschversuche, Drogen – waren durch die Intervention der USA extrem begünstigt, wenn nicht gar verursacht worden, die die Bildung sozialistischer Regierungen „vor ihrer Haustür“ unterbinden wollten. Die ausgewählten Filme reflektieren dies in zweierlei Hinsicht: zum einen durch die Zustände, die sie schildern, zum anderen durch die Verwicklung US-amerikanischer Helden in diese Zustände. Südamerika ist der Ort, den amerikanische Profi- und Wochenendsoldaten besuchen, um westliche Werte zu verbreiten. Und nun: Weiter im Text!
3.3 What makes a hero? – THE MISSION … KILL
Die Frage nach dem Appeal des Actionfilms wird oft intuitiv mit dem Bedürfnis des Publikums nach Helden beantwortet. Eine Antwort, die unmittelbar plausibel und hinreichend scheint. Tatsächlich jedoch beginnen mit ihr erst die Probleme. Der Held ist so gesehen nur ein Instrument, mit dem sich Ideologien verkaufen lassen: Und je strahlender und stolzer er ist, umso mehr lenkt er von diesen hinter ihm stehenden Ideologien ab. Nur wenige Actionfilme thematisieren den Helden als Macht- und Propagandainstrument ganz direkt. THE MISSION … KILL ist einer von ihnen.
J. F. Cooper (Robert Ginty), genannt Cobra, ist ein ehemaliger Marine, der sich jetzt als Sprengmeister verdingt: Sein lakonischer Kommentar, dass ihm mehr für seine Sprengung eines Hauses bezahlt wird als den Bauarbeitern für die Errichtung, charakterisiert ihn als Realisten, der sich längst keinen Illusionen mehr hingibt und den Lauf der Welt distanziert, aber durchaus amüsiert beobachtet. Als er seinen alten Armeekumpel Harry (Cameron Mitchell) besucht, der als LKW-Fahrer in dubiose Geschäfte verwickelt ist, lässt er sich von dessen jüngerer Ehefrau dazu überreden, ihn bei einer Tour zu begleiten, um auf ihn aufzupassen: Harry soll die Rebellen, die im mittelamerikanischen Zwergstaat Santa Maria gegen die Militärdiktatur Präsident Aribans kämpfen, mit Waffen beliefern. Es kommt, wie es kommen muss: Harry fliegt auf und wird ermordet, J. F. kann entkommen und landet unter dem Namen „Kennedy“ eher zufällig auf der Seite der Rebellen, wo er mit seiner Militärerfahrung schnell zum Anführer aufsteigt. Dank des amerikanischen Journalisten Bingo Thomas (Sandy Baron), der genau weiß, was das Volk daheim lesen will, wird „Kennedy“ schnell zur Symbolfigur des tobenden Freiheitskampfes, zum modernen Robin Hood. Doch das ruft Neider in den Reihen der Rebellen auf den Plan …
Am Anfang war das Wort. Der Film beginnt mit dem Voice-over-Erzähler Bingo Thomas, der an seiner Schreibmaschine in einem kleinen Hotelzimmer in Santa Maria sitzt und seinen neuesten Artikel schreibt. Seine Beschreibungen der herrschenden Zustände werden unmittelbar verifiziert, wenn die Kamera von ihm weg- und aus seinem Fenster über die Straße schwenkt, wo Militärs Aufständische niederschießen und deportieren und ein Rebell an einem Fahnenmast erhängt wird. Der Journalist als Berichterstatter, Chronist und Aufklärer: Seine geschriebenen Worte repräsentieren die Wirklichkeit. Aber die Reihenfolge der Bilder lässt schon aufmerken und deutet an, dass der Journalist ein Instrument in der Hand hält, mit dem er Realität nicht nur abbilden, sondern mitgestalten kann.
Als „Kennedy“ von den Regierungstruppen festgenommen, inhaftiert und ohne große Umstände zum Tode verurteilt wird, ist Bingo Thomas folglich sogleich zur Stelle, um sich die Exklusivrechte an dessen Geschichte zu sichern. Ein Amerikaner, der sich den Rebellen – wie es das Klischee verlangt, grundgut, aber leider völlig naiv und noch dazu sowohl schlecht ausgebildet als auch schlecht ausgerüstet – im Kampf gegen einen übermächtigen Militärapparat anschließt: Das ist der Stoff aus dem Legenden sind. Dass J. F. gar kein Interesse daran hat, Held in einem fremden Konflikt zu sein, stört Bingo nicht. Wenn nur Sekunden später die Rebellen die Wand zu J. F.s Zelle einreißen, um seinen Zellengenossen – und ihn – zu befreien, dann scheint es fast so, als sei diese Aktion von dem Journalisten förmlich herbeiimaginiert worden, damit seine in Gedanken bereits verfassten Artikel Wirklichkeit werden können.
Tatsächlich gewinnt „Kennedy“ das Vertrauen der Rebellen, nachdem sie ihn zunächst wie einen Gefangenen behandeln. Es ist ein Dialog über klassische amerikanische Filmschauspieler – Burt Lancaster, Robert Mitchum, John Wayne –, der das Eis schmelzen lässt. Die mit dem Kino verbundenen Träume verbinden die Menschen auch über Sprach- und Landesgrenzen hinweg. Und diese Träume werden durch nichts so gut verbildlicht wie durch starke, aufrechte Heldenfiguren. J. F. weiß es noch nicht, aber er ist im Begriff selbst eine solche Identifikationsfigur zu werden. Doch diese Zuschreibungen sind nicht für die Ewigkeit, sie ändern sich schnell, und der Weg vom Helden zum Sündenbock kann sehr kurz sein. Und Helden sind genauso ersetzbar wie Schurken: Wenn Präsident Ariban beim finalen Sturm der Rebellen auf seinen Palast erschossen wird, ist sofort sein Geschäftspartner, der schmierige Millionär Borghini (Henry Darrow) zur Stelle, seinen Platz zu übernehmen. Als J. F. diesen auf dem Weg zu seiner Ernennung umbringt, steht sofort dessen skupellose Ehefrau (Merete Van Kamp) bereit, für ihn einzuspringen. „Kennedy“ und die Rebellen haben nichts gewonnen. Nur die Namen haben sich geändert. Und die Geschichte vom amerikanischen Robin Hood in einem lateinamerikanischen Konflikt, die die Leser für ein paar Monate gefesselt hat, muss ohne Happy End auskommen.
THE MISSION … KILL ist ein ungewöhnlich komplexer Film dafür, dass er eine eher kleine Produktion ohne große Stars ist, und als solcher ein Paradebeispiel dafür, wie lebendig das Actionkino in den Achtzigerjahren war. Viele dieser Filme kamen bei uns nur auf Video heraus und sind weit davon entfernt, irgendwann eine Wiederveröffentlichung zu erfahren. Dieser hier lässt erahnen, was für Schätzchen möglicherweise Gefahr laufen, für immer vergessen zu werden. Die Besetzung von Robert Ginty, der in James Glickenhaus‘ meisterlichem THE EXTERMINATOR die Titelrolle spielte, ist ein kluger Schachzug, eben weil er verglichen mit den weiter oben genannten Filmikonen Lancaster, Wayne und Mitchum eher unscheinbar ist. Jeder hat das Zeug zum Helden: Er muss nur dazu gemacht werden. Und Santa Maria, ein typischer lateinamerikanischer Zwergstaat, in dem sich die schwelende Unruhe durch einen kleinen Anstoß jederzeit zu einem handfesten Krieg ausweiten kann, scheint ein idealer Brutplatz für solche Helden.
3.4 Once more, without feeling: DELTA FORCE 2: THE COLOMBIAN CONNECTION
Als das Sequel zu Menahem Golans THE DELTA FORCE 1990 erschien, da war der Actionfilm bereits in einem Wandel begriffen. Zwei Jahre zuvor war RAMBO 3 mit rund 60 Millionen Dollar der bis dahin teuerste Film aller Zeiten gewesen. Seine Rekordmarke sollte der Überbietungslogik des Filmgeschäfts zufolge zwar nicht allzu lange Bestand haben, dennoch markierte er einen Endpunkt: Nie wieder wurde danach eine solche exzessive handgemachte Materialschlacht betrieben. DELTA FORCE 2 betreibt auf etwas niedrigerer Ebene noch einmal großen Aufwand, brennt ein gigantisches Feuerwerk ab und wirkt dabei krass überdimensioniert. Eine der letzten großen Machtdemonstrationen der zu diesem Zeitpunkt schon im Schwinden begriffenen Cannon. Auch an seinem Star Chuck Norris war nicht vorübergegangen, dass die Herrschaft der wortkargen Haudraufs langsam zu Ende ging und neue, charmantere, witzigere, intelligentere, schlagfertigere Helden gefragt waren. Sein Versuch, 1988 in HERO & THE TERROR einen Imagewechsel vom unbesiegbaren, schweigsamen Pokerface zum gebrochenen, von Ängsten und Selbstzweifeln geplagten Antiheld zu vollziehen, schlug fehl. Niemand wollte einen Chuck Norris sehen, der sich einer Psychotherapie unterzog, von Albträumen aus dem Schlaf geschreckt wurde und seiner Geliebten beim Candlelight-Dinner einen Heiratsantrag machte. Folgerichtig kehrte er unter der Regie seines Bruders Aaron Norris nicht nur zu einem seiner erfolgreichsten Filme zurück, er lieferte in der Rolle des Colonel Scott McCoy auch eine besonders eindimensionale Interpretation seiner Persona ab. DELTA FORCE 2 ist also in jeder Hinsicht ein anachronistischer Film.
Er handelt von der Jagd auf den Drogenzar Ramon Cota (Billy Drago), der sich dem Zugriff amerikanischer Beamten mehrfach entziehen kann, sei es durch eigenes Geschick oder die genretypische Laxheit der amerikanischen Justiz, die den festgesetzten Schwerverbrecher für eine lachhafte Kaution auf freien Fuß lässt, nachdem es einmal gelungen ist, ihn festzunehmen. Nachdem er Major Bobby Chavez (Paul Perri), den Partner Scott McCoys (Chuck Norris), und dessen Familie umgebracht hat, sinnen McCoy und sein Vorgesetzter, General Taylor (John P. Ryan), auf Rache. Der US-Präsident gestattet schließlich höchstpersönlich die Intervention in San Carlos (entgegen der Behauptung des Titels ist die Geschichte in einem fiktiven Staat angesiedelt, der jedoch zweifellos als Stand-in für Kolumbien fungiert) ein Moment, der von Taylor und McCoy mit großer Genugtuung gegenüber dem südamerikanischen Wachhund ausgekostet wird und ein treffendes Bild US-amerikanischer Arroganz, der schwierigen politischen Beziehung der USA zu Südamerika und ihrer Interventionsgeilheit abgibt –, und so marschiert McCoy schwer bewaffnet in San Carlos Land ein und schlägt sich mithilfe einer Rebellin bis zu Cotas luxuriösem Anwesen hoch auf einem Berggipfel durch, um ihm den Garaus zu machen.
DELTA FORCE 2: THE COLOMBIAN CONNECTION ist ein Film der Extreme und Gegensätze: Seine Länge von rund 110 Minuten, die breit angelegte Handlung, die sich über zwei Kontinente erstreckt und dabei Elemente des unterkühlten, harten Agentenfilms mit denen des Over-the-Top-Actioners verbindet, gleichzeitig (wie schon der Vorgänger) mit der Bezugnahme auf aktuelle politische Konflikte Relevanz vorgaukelt (Ramon Cota ist eindeutig an den kolumbianischen Drogendealer Pablo Escobar angelehnt), weisen ihn als selbstbewussten, ambitionierten Blockbuster aus. Demgegenüber steht die ungelenke, klobige und raffinessenarme Inszenierung von Aaron Norris, die sich seinem Bruder, der mit zombiehafter Stoik durch den Film walzt wie eine mitleidlose, gleichgültige Naturgewalt, als perfekter Komplize zur Seite stellt und die zahllosen Brutalitäten des Films als stumpf, abstoßend und dreckig erscheinen lässt, ohne dass das wirklich so intendiert zu sein scheint.
Zwei kurze Szenen, in denen der Regisseur versucht, seinen Bruder in Zeitlupenbildern zur Ikone zu stilisieren, stehen beispielhaft für die missglückten oder zumindest seltsamen Inszenierungsstrategien des Films: Die erste folgt unmittelbar auf den Erhalt der Nachricht vom Tode seines Partners und zeigt McCoy, wie er seine Kontrahenten im Nahkampftraining mit der Effizienz einer Maschine zu Boden streckt. Es wird klar, dass er in diesem Moment seine Emotionen kanalisieren muss: Now it’s personal! Ein typischer Actionfilmmoment, der genau jenen Augenblick markiert, in dem der vorher schon annähernd makellose Held zur zu allem entschlossenen Kampfmaschine wird. Doch Norris‘ Zeitlupe verzärtelt diesen Moment, sie scheint McCoy in diesem Moment der Transition festhalten zu wollen, was nachhaltig irritiert. Warum, das wird beim zweiten Zeitlupeneinsatz deutlich, der während McCoys Infiltration von Cotas Villa erfolgt: Hier umschmeichelt die Kamera den Protagonisten dabei, wie er sich mithilfe einer an der Häuserwand befestigten Fahnenstange in die erste Etage emporschwingt. Diese artistische Einlage ist nicht nur für sich genommen kaum mehr als banal, ihr kommt auch im Rahmen des Showdowns keine besondere Funktion zu. Sie wirkt willkürlich gesetzt, feiert ihr Objekt in einem Moment, der nicht zelebrierungswürdig ist und erreicht so eher das Gegenteil: Sie trivialisiert es.
McCoy ist nicht wegen seiner Taten ein Held, seine bloße Existenz reicht dafür schon aus. Auch wenn er die Armeen Cotas – der neben seinen Drogengeschäften auch die Landbevölkerung unterjocht und natürlich geschäftlich mit dem Staatsoberhaupt seines Landes verbandelt ist – fast im Alleingang überwältigt, so ist das weniger die Leistung eines mit herausragenden Fähigkeiten ausgestatteten Menschen, sondern göttliche Intervention, Erfüllung eines unausweichlichen Schicksals. Auch der Tod Cotas belegt das: An einem Seil an einem Helikopter hoch über den Wolken schwebend, beginnt Cota seinen neben ihm baumelnden Widersacher zu beleidigen, ihm zu drohen und genüsslich von der Ermordung seines Partners zu schwärmen. McCoy grinst nur. Er hat gesehen, dass das Seil, an dem Cota hängt, jede Sekunde reißen wird. Mit tiefer Genugtuung und voller Vor- und Schadenfreude schaut er Cota beim Sturz in den Tod zu. Er muss keinen Finger mehr rühren, hat das Schicksal auf seiner Seite.
Chuck Norris war nie ein besonders expressiver Actiondarsteller, doch in DELTA FORCE 2: THE COLOMBIAN CONNECTION reduziert er seine Palette noch einmal erheblich. Man meint hier nicht länger einem Menschen bei der Arbeit zuzuschauen, sondern dem Tod höchstpersönlich. Ein Eindruck, den Norris & Norris offensichtlich teilten: In ihrem nächsten gemeinsamen Film, THE HITMAN, spielt Chuck Norris einen Polizisten, der von den Toten wiederaufersteht, um im schwarzen Staubmantel, mit langen Haaren und abgesägter Schrotflinte seine eigene „Ermordung“ zu rächen …
3.5 Die nach Kolumbien gehen: MC BAIN
James Glickenhaus‘ letzter Actionfilm beginnt dort, wo der US-amerikanische Actionfilm der Achtziger ideell aus der Taufe gehoben wurde: in Vietnam. Die G.I.s Roberto Santos (Chick Vennera), Frank Bruce (Michael Ironside), Eastland (Steve James) und Gil (Thomas G. Waites) haben soeben die Nachricht erhalten, dass der Krieg beendet ist und steigen in einen Helikopter, um die erste Etappe ihrer Heimreise anzutreten. Doch auf dem Weg entdecken sie ein Kriegsgefangenenlager des Vietcong und beschließen zu landen, um etwaige zurückgebliebene amerikanische Gefangene zu befreien. Tatsächlich gelingt es ihnen so, McBain (Christopher Walken) vor seiner Exekution zu bewahren. Jahre später erfährt McBain von der Kolumbianerin Christina (Maria Conchita Alonso), der Schwester Robertos, dass ihr Bruder, ein Anführer in der Rebellion gegen den diktatorischen und sein Volk unter Drogen setzenden Präsidenten (Victor Argo), bei einem Putschversuch vor laufenden Kameras ermordet wurde, und bittet McBain um Hilfe. Weil der seinem alten Freund das Leben verdankt, trommelt er seine Armeekumpels zusammen und reist mit ihnen nach Kolumbien, um den mittellosen Rebellen beim Umsturz zu helfen.
MC BAIN fällt zunächst einmal durch seine unübersehbare Reminiszenz an Michael Ciminos THE DEER HUNTER auf: Als schwer traumatisierter Vietnamveteran Nick vermittelte Christopher Walken in diesem Film einen nachhaltigen Eindruck, welche schrecklichen psychischen und seelischen Schäden der Krieg dem Menschen zufügen kann, und wurde für diese Leistung 1979 zu Recht mit dem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Glickenhaus geht mit MC BAIN natürlich einen weitaus weniger schwierigen Weg als Michael Cimino mit seinem epischen Antikriegsfilm. Auch wenn er mit seiner Zeichnung der politischen Zustände in Kolumbien, der Allianz von Politik und Drogenindustrie und der Stillhalte-Strategie der amerikanischen Regierung an die Realität anknüpft, so geht es ihm vor allem darum, ein ordentliches Action-Feuerwerk abzubrennen. Doch der Kniff, dieses durch die Mitwirkung Walkens und die Vorgeschichte von dessen McBain ikonisch mit dem großen Antikriegsfilm-Klassiker zu verknüpfen und ihn als eine Art pulpiges What-if-Sequel anzulegen, verrät ein Maß an Reflexion, Intelligenz und Witz, das ihn von vergleichbarer eskapistischer Massenware abhebt.
Tatsächlich nimmt sich Glickenhaus für einen Actionfilm aufreizend viel Zeit, um den Einmarsch der Helden in Kolumbien vorzubereiten. Nach der Auftaktsequenz widmet er sich den Bemühungen Robertos, El Presidente zu stürzen, zeigt ihn, wie er mit seinem kleinen Kommando in dessen Palast eindringt und ihn vor laufenden Fernsehkameras zum Rücktritt zwingt. Als das misslingt – bezeichnenderweise deshalb, weil die USA den Rebellen ihre Unterstützung versagen –, Roberto selbst live und in Farbe erschossen wird, begibt sich seine Schwester auf die Reise nach New York, wo sie McBain aufsucht, der Roberto noch einen Gefallen schuldet und sofort seine alten Freunde zusammentrommelt. Doch bevor sie zu ihrer Mission aufbrechen können, müssen sie erst noch das nötige Kleingeld auftreiben. Zu diesem Zweck statten sie diversen Gangstern einen Besuch ab, erbeuten bei denen Bargeld und Ausrüstung. Erst nach der folgenden Besprechung und Planung treten sie die Reise nach Kolumbien an. Nach diesem langen Vorlauf beginnt mit dem letzten Drittel des Films aber auch schon der Showdown: Bereits auf dem Luftweg nach Kolumbien wird die Maschine der Freunde von der kolumbianischen Luftwaffe attackiert. Ein befreundeter und engagierter Pilot kann die Angreifer jedoch mit seinem Kampfflugzeug ausschalten und die Landung des Einsatzkommandos um McBain ermöglichen.
Der Weg zum Palast von El Presidente gliedert sich danach in kleine Etappen und Set Pieces: Es muss nichts mehr gesagt werden, die Zeit für Taten ist gekommen. Auch hier unterscheidet sich MC BAIN von ähnlichen Filmen, die meist noch die Vermittlung der unterschiedlichen Kulturen, die Annäherung der amerikanischen Helden an den fremden Horizont thematisieren, um so eine menschelnde Botschaft ins blutige Geschehen zu mischen. MC BAIN zeigt einfach Profis bei der Arbeit. Zwar bleibt kein Zweifel daran, dass sie sich für die gute Sache engagieren und integre Typen sind, doch lässt ihnen ihre Aufgabe keinen Raum für Sentimentalitäten. Diese kommen eher der Figur der Christina zu, die tränenreich das Leid der armen geknechteten Bevölkerung verkörpern darf und gegen Ende per weltweit versendeter Fernsehbotschaft die Solidarität der Weltgemeinschaft einfordert. Wie schon in THE MISSION … KILL ist Südamerika weniger als konkreter geografischer Ort, sondern vielmehr als Dystopie zu verstehen, in der alle gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Probleme ins Extrem gesteigert sind und ein an altertümliche Tyranneien erinnerndes Herrschaftssystem etabliert wurde, das drastische Maßnahmen erfordert.
Glickenhaus gelingt es, seinen Film mit derselben Präzision, Effizienz und jeder Freiheit von Selbstzweifeln abzuspulen, die auch die Söldner um McBain bei der Erfüllung ihrer Aufgabe an den Tag legen. Ein Rädchen greift ins nächste, treibt die gut geölte Maschine auf ihrem Weg zum Ziel unaufhaltsam an. Doch die gute Laune, mit der McBains Freunde ihr Handwerk ausüben, die Euphorie, mit der der gewaltsame Tod des Diktators und der Aufbruch in eine ungewisse Zukunft am Ende gefeiert werden, haben ja auch etwas sehr Beunruhigendes. Oder anders: Gerade in der Abwesenheit jeden Zweifels, jeder Relativierung verstört der Film. Es bleibt unklar, wie man die geschilderten Vorgänge bewerten soll: Sind seine Protagonisten Kämpfer für das Gute, die leider vor Irrtümern nicht immer gefeit sind (siehe Vietnam)? Oder sind sie nicht eigentlich viel eher traurige Gestalten, die nichts selbst erschaffen, sondern nur zerstören können, und immer im Dienste anderer stehen, über deren Beweggründe sie nichts wissen?
Auch wenn Glickenhaus diese Frage nicht direkt stellt und seinen Helden mit viel Sympathie begegnet, so tritt sie doch in einem Monolog McBains kurz hervor: Nachdem Christina ihm vom Leid ihrer Mitbürger berichtet hat, erzählt er, wie er als Jugendlicher in Woodstock war, wie er Drogen genommen, drei Tage lang im Schlamm gesessen habe und glücklich dabei war. Wieder zu Hause habe er einen Zeitungsartikel über Woodstock gelesen, der das Festival grob darauf reduzierte, dass Jugendliche stoned im Dreck gesessen hätten. „Damals habe ich gedacht: Was für ein Idiot. Er hat uns gar nicht verstanden. Heute denke ich: Er hat uns doch verstanden.“ Neben der konservativen Abrechnung mit alten, überkommenen Hippie-Idealen und einer letztlich gescheiterten Bewegung, kommt darin noch etwas anderes zum Vorschein. Da ist ein Mann, der sich selbst nicht vertraut, dessen Einblicke in die conditio humana ihn tief verstört haben. Seine Reaktion ist es aber gerade nicht, in Tatenlosigkeit zu verfallen, wie es folgerichtig wäre. Er zieht aus alter Verbundenheit in einen fremden Krieg, in dem Gut und Böse anscheinend klar voneinander zu trennen sind. Krieg als Selbstfindungstrip.
3.6 Hölle Südamerika: THE EVIL THAT MEN DO
Für den letzten Film möchte ich die bis hierhin eingehaltene chronologische Reihenfolge aufbrechen. Ich denke, dass das durchaus sinnvoll ist: Zum einen fällt J. Lee Thompsons THE EVIL THAT MEN DO aus dem Korpus der von mir ausgewählten Filme am weitesten heraus, weil er ein eher verhaltenes Erzähltempo anschlägt und weniger auf breit ausgewalzte Actionszenarien setzt, als vielmehr auf die „intimere“ Konfrontation von Mann gegen Mann, mithin richtiger als „Thriller“ zu bezeichnen wäre. Zum anderen, weil seine konkreten historischen Bezüge zwar offensichtlich sind, er seine Verortung in der Realität aber vor allem nutzt, um von dort aus über den Zustand der Menschheit insgesamt zu reflektieren. Thompson erzählt die Geschichte des ehemaligen Profikillers Holland (Charles Bronson), der auf den mengele’schen Folterarzt Dr. Molloch (Joseph Maher) angesetzt wird, nachdem dieser Hollands Freund umgebracht hat. Molloch hat seine „Künste“ zahlreichen Terrorherrschern zur Verfügung gestellt und dabei Tausende von Menschen gequält, verstümmelt und ermordet, konnte sich dem Zugriff von militanten Menschenrechtlern jedoch immer erfolgreich entziehen. Holland, selbst ein vielfacher Mörder, der sich über die Menschheit keinen Illusionen mehr hingibt und deshalb auf einer einsamen Insel seinen Ruhestand genießt, beschließt, einmal – ein letztes Mal? – etwas Gutes zu tun und die Welt von dem gemeinen Mörder im Gewand des distinguierten Wissenschaftlers zu befreien.
THE EVIL THAT MEN DO beginnt mit einer unerträglich brutalen Sequenz, einer Demonstration von Mollochs Handwerk, die man während des gesamten restlichen Films nicht mehr vergisst. In technisch-sachlichem Ton spricht er – ein distuinguierter Gentleman mit aristokratischem Schnurrbart – vor dem anwesenden Publikum, dem er sich andient, von seinen Errungenschaften im Quälen von Menschen, als ginge es dabei um die Bearbeitung anorganischen Materials. Das Brechen des menschlichen Willens, die systematische Demütigung der Opfer, die vollständige Zerstörung der Körpers, die radikale Vernichtung jeder Würde hat er zu wissenschaftlichen Disziplinen erhoben. Um seine Fortschritte zu illustrieren, holt Molloch einen Mann in den Behandlungsraum, den er entkleidet, in eine Vorrichtung hängt und dann am ganzen Körper – auch an den Hoden – mit Elektroden versieht, durch die danach Stromstöße gejagt werden, bis die Schmerzenschreie verstummen und nur noch ein blutender Leichnam übrig ist. Diese Sequenz wird von einem dräuenden Grollen untermalt, das nur von stählern klingenden Schlägen unterbrochen wird, die keinen anderen Schluss zulassen, als dass man es bei Molloch mit dem Teufel höchstpersönlich zu tun hat. Wenig später betrachtet Holland ein Videoband, auf dem Überlebende von Mollochs Foltermethoden berichten. Es handelt sich um einfache Interviewaufnahmen deren ruhiges statisches Framing – man sieht die Opfer von den Schultern aufwärts – die Unglaublichkeit ihrer Berichte noch unterstreicht. Was man zu hören bekommt, treibt einem die Galle hoch, lässt einen angesichts dieser krassen Abwesenheit jeden Mitgefühls, jeder Empathie, jedes noch leise glimmenden Funken Mitgefühls fassungslos und traurig zurück. Die Grenze zwischen Fiktion und Dokumentation wird von Thompson ohne Unterlass traktiert.
Eine weitere Steigerung des Grauens ist nach diesem Auftakt nicht mehr denkbar – zumindest nicht in einer kommerziellen Filmproduktion. J. Lee Thompson führt den Film danach dann auch in ruhigere Fahrwasser und in die Konvention, ohne seinen Ansatz dabei jedoch zu verraten. THE EVIL THAT MEN DO wendet sich von Molloch (was für ein Name!) ab und Holland zu, der sich über die Gewohnheiten seines Opfers und seiner Gehilfen informiert und damit beginnt, letztere einen nach dem anderen aus dem Weg zu räumen. Doch dieser Molloch, seine Gräueltaten und die Geschichten seiner Opfer, denen er unvorstellbare Schmerzen zugefügt und deren Leben er zerstört hat, werfen weiterhin einen Schatten über die Vorgänge: Wenn er der Teufel ist, dann ist das Südamerika von Thompsons Film die Hölle, ein Ort, an dem Menschenleben nichts wert sind und der Einzelne spurlos verschwindet, wenn er sich mit den Falschen anlegt. Die Höllenassoziation wird neben der flirrenden Hitze, die den Figuren den Schweiß aus den Poren treibt, und der brennenden Sonne, die den Film in ein gleißendes Licht taucht, auch durch eine unübersehbare Sexualisierung der Gewalt und der Beziehungen untermauert.
Schon die eben beschriebene Eingangssequenz war entsprechend konnotiert, es gesellen sich weitere Beispiele hinzu: Als die Südamerikanerin Rhiana Hidalgo (Theresa Saldana), die Tochter des Folteropfers vom Anfang, die sich als Hollands Ehefrau ausgibt, in einer schäbigen Spelunke von einem riesenhaften Typen mit groteskem Schädel angemacht wird, der auch auf Warnung Hollands hin
nicht von ihr ablassen will, ergreift der Profikiller mit beiden Händen dessen Schwanz durch die Hose, drückt zu und zwingt den Mann so zu Boden. Mit dieser Aktion erregt Holland wiederum die Aufmerksamkeit eines von Mollochs Männern, der sich als bisexuell zu erkennen gibt und gern mit Pärchen ins Bett steigt. Auch Mollochs treue Assistentin, seine Schwester, eine ältere Dame, ist homosexuell, verlustiert sich mit einer deutlich jüngeren Prostituierten. Der Film wird so zu einer sehr übersteuerten körperlichen Erfahrung: Liebe, Sex, Folter, Schmerz, Tod sind untrennbar aneinander gekoppelt und vertauscht. Während Molloch ohne sichtbare emotionale Regung Körper manipuliert und Leben zerstört, stürzen sich die Menschen um ihn herum in leere, aber dafür exzessive Sexbeziehungen. In Thompsons Film werden die Gemälde eines Hieronymus Bosch lebendig: Die Menschheit scheint völlig die Orientierung verloren zu haben und alles, was man noch tun kann, ist sie mit einem Donnerschlag auszulöschen.
Das Ende lässt kaum eine andere Deutung zu: Das „Privileg“, über Molloch zu richten, obliegt nicht Holland, sondern einer Armee verkrüppelter Minenarbeiter, Opfern von Mollochs Folterkunst, die sich zum Finale in der Mine ihrem alten Peiniger gegenüber sehen und sich wie ausgehungerte Raubtiere auf ihn stürzen (Parallelen zu Erle C. Kentons Horrorfilm-Klassiker ISLAND OF LOST SOULS, in dem die geschundenen Tiermenschen ihren Schöpfer Dr. Moreau förmlich zerreißen, sind unverkennbar). Doch auch diese Auflösung bringt keine Katharsis: Gnade und Mitgefühl sind abwesend in der Welt der Menschen, die Zivilisation hat sich in einen Dschungel verwandelt, Wahnsinn regiert. Man kann so nicht mehr leben. Holland kehrt am Schluss auf seine Insel zurück. Man darf vermuten: für immer.
4. Schluss
Mit den von mir ausgewählten Filmen wollte ich einen kleinen Einblick in eine kleine, aber feine Gruppe von Actionfilmen ermöglichen: einer Gruppe, die sich zuerst nur durch ein gemeinsames Setting auszuzeichnen scheint, tatsächlich aber doch noch einige Gemeinsamkeiten mehr aufweist. Die von Aufständen und Bürgerkriegen, von Unterdrückung und Auflehnung geprägten Länder Südamerikas, mit ihren mit Drogen ruhig gestellten und mit Waffenlieferungen wieder aufgeschreckten Bürgern, bieten einen idealen Boden für den Actionfilm mit seinen heldenhaften Tatmenschen. Hier finden sie ein politisches Klima vor, das einzig dafür gemacht zu sein scheint, ein extremes Konfliktpotenzial zu erzeugen: wie ein maßstabsgetreuer Real-Life-Simulator für Militärstrategen, Elitesoldaten und Hobbysöldner. Doch mit dem Zusammenbruch der UdSSR und der damit geschwundenen Bedrohung durch den Kommunismus hat sich dies geändert. Heute, wo der Actionfilm meist abgekoppelt ist von realen Konflikten, ist Südamerika ein Schauplatz, der zwar noch bestimmte Assoziationen anstößt, eine bestimmte Bilderwelt mitbringt, aber an Relevanz verloren hat. Nur die Drogen, die kommen immer noch aus Kolumbien und gewährleisten einen stetigen Nachschub lateinamerikanischer Drogenbarone.
Während ich diesen Essay geschrieben habe, sind mir natürlich noch ein paar Filme eingefallen, die ich hätte berücksichtigen können: darunter etwa Luis Llosas exzellenter SNIPER (SNIPER – DER SCHARFSCHÜTZE, USA/Peru 1993), in dem zwei US-amerikanische Scharfschützen den Auftrag erhalten, einen Rebellenführer zu erschießen, Daniel Petrie Jrs. TOY SOLDIERS (BOY SOLDIERS, USA 1991), in dem südamerikanische Terroristen eine amerikanische Militärakademie überfallen, die Schüler als Geiseln nehmen, aber nicht mit deren Gegenwehr gerechnet haben, oder aber Jun Gallardos FIRING LINE (DER KAMPFGIGANT 2, USA/Philippinen 1988), in dem ein amerikanischer Soldat für eine Disziplinlosigkeit im Kampf gegen südamerikanische Rebellen bestraft wird und sich in der Folge auf deren Seite durchschlägt. Letzterer ist auch insofern interessant, als er den Südamerika- mit dem Philippinen-Actioner kurzschließt: Beide sind nicht immer leicht voneinander zu trennen. Was ich mit dieser kurzen Aufzählung sagen will: Es gibt noch Einiges zu entdecken. Mein Text sollte als Anregung für eigene Streifzüge durch den südamerikanischen Regenwald verstanden werden. Viel Spaß dabei!










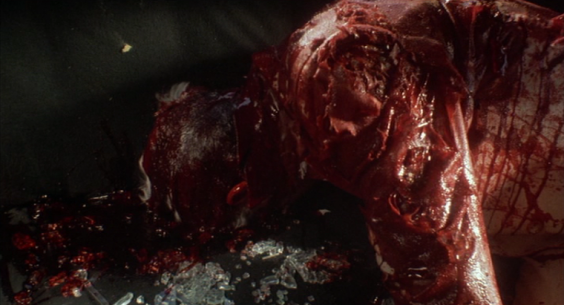










4 Kommentare zu "Oh, wie schön ist Panama – US-amerikanische Actionhelden in Lateinamerika (Teil 2)"
Hallo Oliver,
sollte dir nochmal der Sinn nach einer so beeindruckenden Doktorarbeit stehen, würde mich das Thema „Rocky Mountain Thriller“ sehr freuen (so in Richtung „Switchback“ oder „Shoot to kill“).
Gruß, Simon
PREDATOR hatte ich genau aus dem von dir geschilderten Grund nicht genommen, wobei er dadurch ja auch wieder besonders gut reingepasst hätte: Lateinamerika eben nicht als konkreter politischer Schauplatz, sondern als ideologisch weitestgehend unvorbelastete Bilderwelt. Worum es in den Scharmützeln zwischen beliebeigen südamerikanischen Regierungen und beliebigen südamerikanischen Rebellen geht und ging, weiß kein Mensch. Aber dass es diese Scharmützel gibt, ist ein Allgemeinplatz. In Südamerika, da sitzen die Präsidenten mit den lustigen Uniformen, und im Busch hocken die Guerillas.
Den LA-Actioner als Vietnam-Allegorie zu begreifen, erscheint mir als etwas zu viel des Guten: Dann ist Vietnam bald wirklich überall. Dass mit SOLDIER BLUE ja sogar ein Indianerwestern als Vietnamallegorie konzipiert worden war, zeigt m. E. nach nicht so sehr, dass man überall Vietnam sehen kann, sondern dass sich in Vietnam auch bloß ein bekanntes Muster wiederholt hatte: die alte David-gegen-Goliath-Geschichte. Und die liefert nunmal eine spannende Grundlage für etliche Filme in etlichen Genres (die Komödie etwa kommt ja fast gar nicht ohne dieses Gegensatzpaar aus). Was ich sagen will: Im Grunde erzählt der Actionfilm fast immer dieselbe Geschichte. :)
Neben der Tatsache, dass die Konflikte in Lateinamerika die Menschen in den USA, von wo die Filme meist kamen, beschäftigten, hat ihre vorübergehende Beliebtheit in den Achtzigern natürlich auch mit der von dir genannten Abwechslung zu tun. Ein anderer Schauplatz, andere Figuren, andere Konflikte: Das bürgt für Wiedererkennungswert im Einerlei. Zumal Vietnam in den Achtzigern ja auch schon wieder ein paar Jahre zurücklag. Als Wolfgang Petersen Mitte der Neunziger Werbung für seinen AIR FORCE ONE machte, da antwortete er auf die Frage, was seinen Film von anderen zeitgenössischen Actionfilmen abhebe, dass bei ihm die Russen die Bösen seien. Er meinte das tatsächlich Ernst. Aber natürlich hatte er seinerzeit nicht ganz Unrecht damit.
Hallo Oliver,
dies ist nicht mein endgültiger Kommentar, nur so als Überlegung;-) Ich musste während dem Lesen die ganze Zeit an PREDATOR denken, der ja viele Elemente des Lateinamerika-Actioners hat (abgesehen natürlich vom Schauplatz;-), diesen aber dann quasi hinter sich lässt, zumindest schonmal im Plot: nach dem Angriff auf das Lager teilt der Film fast nur noch den Schauplatz mit dem LA-Actioner (ähm, nicht L.A., wobei?) – PREDATOR wird ja gemeinhin als Vietnam-Allegorie verstanden – könnte man dieses Verständnis auf den LA-Actioner allgemein übertragen? Bzw. ist diese Hinwendung nach Lateinamerika vielleicht als ein Müdewerden mit dem Vietnam-Bezug zu verstehen, als ein Versuch auch etwas zeitgemäß relevanter zu sein (ok, den Punkt arbeitest du ja durchaus heraus, sorry)?
Ein weiterer LA-Bezug, der vielleicht bezeichnend ist, wäre LICENSE TO KILL, sprich: der Versuch des Bond-Franchises auf diesen Zug aufzuspringen.
Und was ist mit Eastwoods Grenada-Ausflug (spezifischer historischer Bezug) HEARTBREAK RIDGE?
Grüße aus Kölle
Trackbacks für diesen Artikel